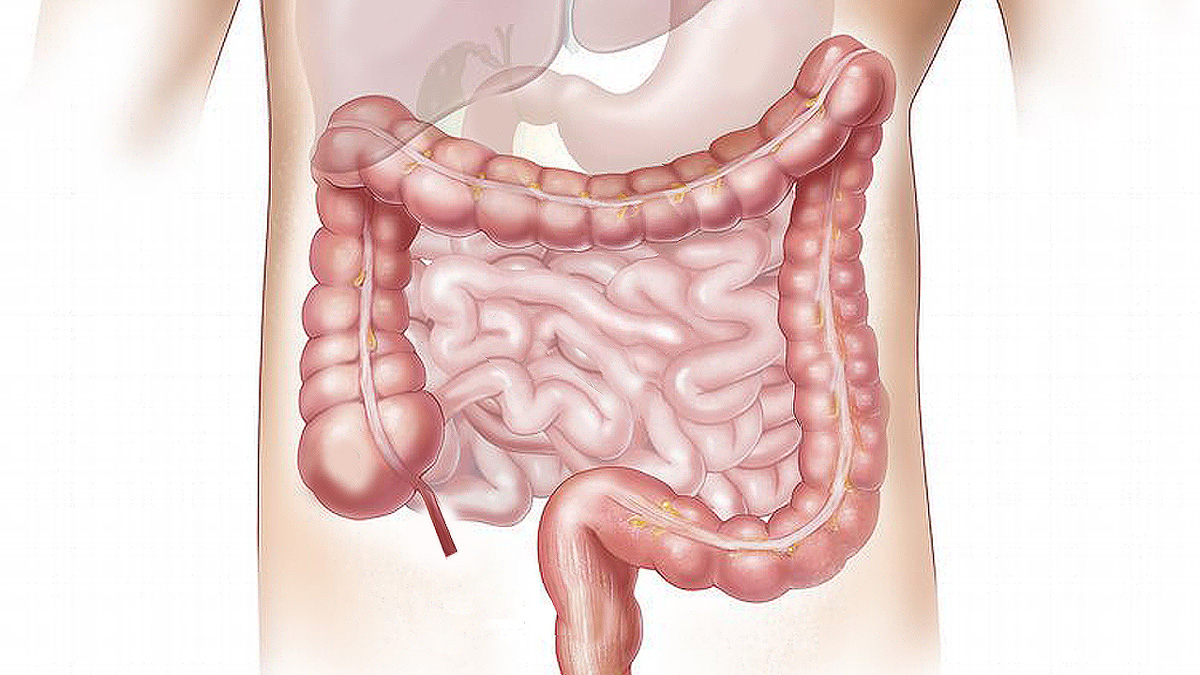
Reizdarm: Was ist das?
Als Reizdarm bezeichnet man eine Funktionsstörung des Darms, die sich durch Bauchschmerzen, Durchfall, Verstopfung oder Blähungen bemerkbar macht. Oft verschlimmert sich die Symptomatik bei Stress.
Der Reizdarm ist für die Betroffenen oft belastend, aber nicht gefährlich. Allerdings kann der Zustand oft chronisch werden. Eine bessere Prognose haben Betroffene, die herausfinden, was ihre Symptome auslöst. Die Krankheit trifft Frauen etwa doppelt so häufig wie Männer.
Beim Reizdarm handelt es sich um eine sogenannte Ausschlussdiagnose, bei der zunächst Krankheiten mit ähnlicher Symptomatik wie infektiöse Darmerkrankungen ausgeschlossen werden müssen.
Die Psyche kann ebenfalls eine Rolle spielen. Oft tritt der Reizdarm gemeinsam mit anderen Erkrankungen auf wie zum Beispiel dem Chronischen Fatigue-Syndrom (ME/CFS), Fibromyalgie oder Spannungskopfschmerzen.
Wie entsteht der Reizdarm?
Zur Entstehung des Reizdarms gibt es verschiedene Ansätze, bis jetzt aber nur wenige gesicherte Erkenntnisse. Inzwischen hat man mehrere Reizdarm-Subtypen identifiziert, die jeweils unterschiedliche Hauptbeschwerden haben. Darüber hinaus können verschiedene Auslöser eine Rolle spielen.
Grundsätzlich ist beim Reizdarm das sogenannte Bauchhirn, also das Darmnervensystem, falsch gesteuert. Darüber hinaus zeigen Studien, dass bei Menschen mit dem Reizdarmsyndrom manche Hirnareale verändert sind.
Dadurch nehmen die Betroffenen Empfindungen im Bauchraum wie die normalen Darmbewegungen eher als schmerzhaft wahr und neigen dazu, sich schneller über mögliche Krankheiten Sorgen zu machen.
Viele Betroffene haben zusätzlich auch psychische Probleme wie Depressionen oder Angststörungen.
Die Krankheitsangst wird dadurch verstärkt, dass sehr viele Untersuchungen bei Reizdarm keine eindeutige Krankheitsursache ergeben und auch manche Ärzte dazu neigen, Beschwerden ohne Befund nicht ernst zu nehmen.
Einige Menschen mit Reizdarm haben eine beschädigte Darmbarriere: Bei ihnen ist die Darmschleimhaut durchlässiger als normal, so dass nicht nur Nährstoffe, sondern auch andere Stoffe in die Schleimhaut eindringen.
Dadurch wird eine Immunreaktion ausgelöst, die zu einer „stillen“ (kaum messbaren) Entzündung führen kann und so die Beschwerden verstärkt.
Das aktivierte Immunsystem kann sich auf den ganzen Organismus auswirken. Auch eine veränderte Darmflora oder eine Dünndarm-Fehlbesiedelung (SIBO) können eine Rolle spielen.
In bis zu 50 Prozent aller Fälle liegt ein gestörter Gallensäurenstoffwechsel vor, so dass im unteren Dünndarm mehr Gallensäure vorhanden ist als aufgenommen werden kann.
Ein sowohl auslösender als auch verstärkender Faktor ist Stress. Bei Stress steigt die Magensaftproduktion an, gleichzeitig nehmen die Darmbewegungen zu und die Immunreaktion im Darm verändert sich.
Reizdarm: Symptome und Diagnose
Reizdarm macht sich oft mit krampfartigen Bauchschmerzen bemerkbar, die häufig im Zusammenhang mit dem Stuhlgang auftreten. Meistens ist der Stuhlgang unregelmäßig, es treten Durchfall und Verstopfung auf, die sich auch abwechseln können.
Ebenfalls typisch ist ein aufgeblähter Bauch, der sich angespannt anfühlt.
Betroffene haben das Gefühl, zu viel Luft im Bauch zu haben und müssen häufig aufstoßen oder leiden unter Blähungen. Oft kommt ein konstantes Völlegefühl dazu, dass nur bei leerem Magen nachlässt. Auch Schleimablagerungen auf dem Stuhl sind möglich.
Achtung: Kommen Fieber, Blut im Stuhl oder starker Gewichtsverlust hinzu, sollte man den Arzt aufsuchen. Diese Symptome sind nicht typisch für Reizdarm und können auf eine ernste Erkrankung hindeuten.
Die Diagnose Reizdarm ist oft kompliziert. Nicht nur unterscheiden sich die Beschwerden von Patient zu Patient, die Symptome treten auch bei vielen anderen Krankheiten auf. Da es sich um eine Ausschlussdiagnose handelt, gibt es keinen Test, der eindeutig auf Reizdarm hinweist.
Im Arztgespräch wird zunächst festgestellt, wie lange die Symptome bestehen, wie häufig sie auftreten und ob sie durch bestimmte Nahrungsmittel verstärkt werden.
Auch Faktoren wie Gewichtsverlust, Blut im Stuhl und Darmkrebs oder entzündliche Darmerkrankungen in der Familie werden einbezogen.
Mögliche Untersuchungen sind Blut- und Stuhluntersuchungen, Ultraschall der Bauchregion, Darmspiegelung oder Tests auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Auch psychische Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen oder Essstörungen sollten abgeklärt werden.
Aktuell wird in der Ärzteleitlinie von einer Bestimmung der Darmflora abgeraten, da die Zusammensetzung des Darmmikrobioms stark variiert und von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird.
Auch ein IgG-Antikörpertest zur Diagnose von Unverträglichkeiten wird nicht empfohlen, da ein Anstieg der IgG-Level im Blut nicht notwendigerweise durch eine Immunreaktion verursacht wird.
Was hilft bei Reizdarm?
Bei der Therapie gibt es zwei Ansätze: Einerseits müssen die Symptome gelindert werden, andererseits sollen mögliche Auslöser identifiziert und eliminiert werden.
Die Ernährung spielt bei der Reizdarm-Therapie eine große Rolle. Allerdings reagieren Reizdarm-Patienten nicht auf einen bestimmten Inhaltsstoff, so dass es für Menschen mit Reizdarm – anders als für Menschen mit Unverträglichkeiten oder Allergien – keine allgemeingültigen Ernährungsempfehlungen gibt.
Deshalb gilt es, die individuellen Trigger zu identifizieren. Hierfür ist ein Ernährungstagebuch hilfreich, dass als Grundlage für eine spezialisierte Ernährungsberatung dient.
Für manche Menschen mit Reizdarm sind Probiotika eine Lösung. Probiotika sind lebende Darmbakterien, die man als Kapsel, Tablette oder Getränk einnehmen kann und die die Darmflora günstig beeinflussen sollen.
Da Stress eine große Rolle bei Reizdarm spielt, können auch psychologische Ansätze helfen. In der kognitiven Verhaltenstherapie lernen Betroffene, mit belastenden Situationen besser umzugehen.