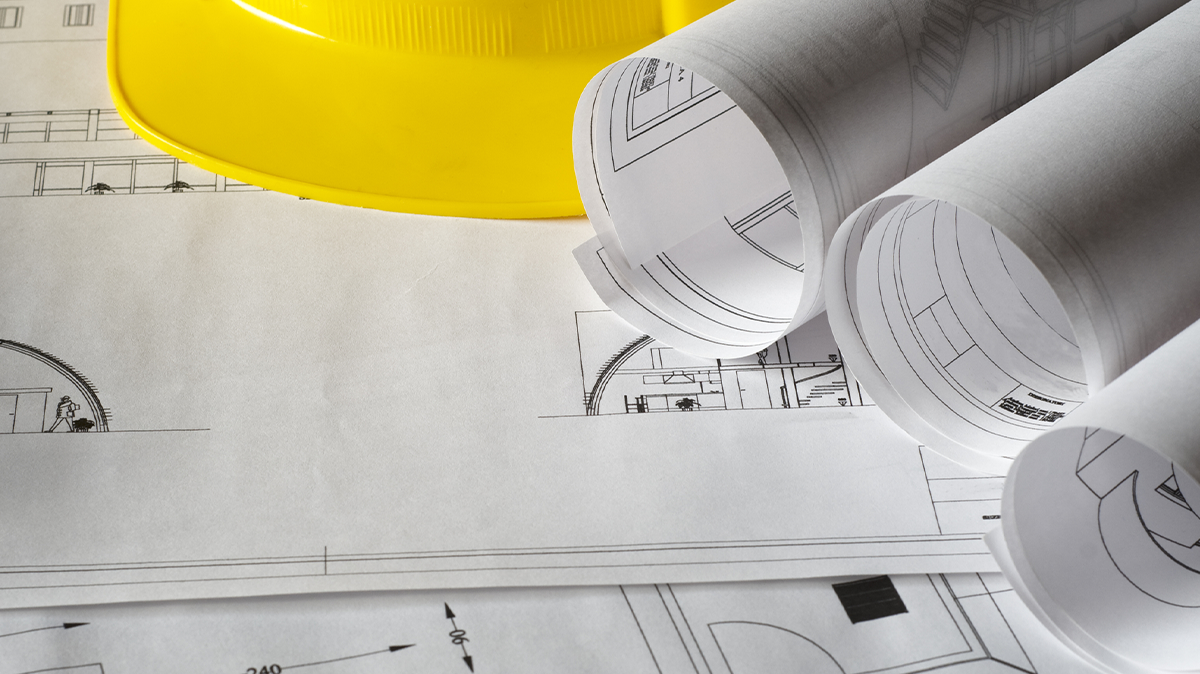
Köln soll in den kommenden Jahren eine unterirdische Intensivstation für den Katastrophenfall bekommen. Für die bei Bedarf schnell einrichtbaren Räumlichkeiten will die städtische Klinikträger-Gesellschaft eine zweistöckige Tiefgarage des Krankenhauses im rechtsrheinischen Merheim entsprechend umrüsten und baulich vorbereiten. Die Pläne machten Axel Goßmann und Daniel Dellmann, die Geschäftsführer der Kliniken der Stadt Köln gGmbH, im Gespräch mit dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ bekannt.
Laut des Geschäftsführer-Duos wolle man mit der „Pop-up-Intensivstation“ auf mögliche Kriege und Krisen, Naturkatastrophen wie die Flut an der Ahr und weiteren Flüssen im Westen Deutschlands im Sommer 2021, oder etwa einen Reaktorunfall gerüstet sein. Laut Goßmann sollten dort Kapazitäten geschaffen werden, um eine große Zahl von Verletzten zugleich behandeln zu können. Sie hätte wohl eine Kapazität von einigen hundert Menschen, wie der WDR berichtet. Ein weiterer Vorteil: Per Aufzug gäbe es eine direkte Verbindung zu den Spezialabteilungen des Klinikums in den Obergeschossen.
Vorbild für unterirdische Intensivstation stammt aus Israel
Die Intensivstation würde nur im Bedarfsfall eingerichtet; im klinischen Tagesgeschäft wäre sie nicht im Betrieb. Dann dienen die Räume im Untergeschoss als normale Tiefgarage. Vorbild der Pläne ist ein Notfallkrankenhaus im israelischen Haifa, das ebenfalls in einer Parkgarage liegt und nur bei Bedarf eingerichtet wird. Die drittgrößte Stadt Israels liegt nahe der Grenze zum Libanon und ist aufgrund dessen besonders von Raketenangriffen der Hisbollah-Miliz bedroht. Die planerischen Zeichnungen für die Kölner Notfall-Intensivstation seien bereits abgeschlossen und das Konzept der NRW-Landesregierung vorgestellt worden, so Goßmann.
Es wäre die erste derartige Intensivstation in Deutschland. Einen konkreten Zeitplan oder eine Finanzierung gibt es derzeit allerdings noch nicht. Für das Projekt strebt die Klinikgesellschaft Fördermittel von Bund und Land an, da die Strukturen nicht dem klinischen Tagesgeschäft dienten, sondern als reiner Vorhalt für den Katastrophenschutz gedacht seien. Die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren seien in die Idee für die neue Station eingeflossen: „Vor fünf Jahren gab es keine Corona-Pandemie, es gab keinen Ukrainekrieg. Eine Vorhaltemedizin, wie sie vor zehn Jahren geplant wurde, sah ganz anders aus als das, was wir nach heutigem Stand brauchen“, so der Co-Klinikdirektor weiter zum „Kölner Stadt-Anzeiger“.
Aus drei mach eins: Städtische Klinikgesellschaft will ihre Einrichtungen in Merheim konzentrieren
Die Pläne fallen zusammen mit einem Großprojekt des städtischen Krankenhausträgers: Dieser will bis 2031 seine bisherigen drei Standorte – das Klinikum Merheim, ein Krankenhaus im ebenfalls rechtsrheinischen Nachbarstadtteil Holweide und das bekannte Kinderkrankenhaus in Riehl, direkt nördlich der Kölner Innenstadt – in Merheim als zukünftig einzigen Standort konzentrieren. Das entsprechende „Klinik-Zukunftskonzept“ hatte der Kölner Stadtrat im Juni 2023 mehrheitlich beschlossen.
Laut des Konzepts soll in Merheim ein „Gesundheitscampus“ neu erbaut werden, vorhandene Gebäude auf dem Areal der Kliniken, die derzeit nur zum Teil bewirtschaftet sind, werden saniert und erweitert. Die ersten Abteilungen sollen ab 2026 vom Krankenhaus Holweide an den zukünftigen gemeinsamen Standort umziehen; das Kinderkrankenhaus erhält auch am neuen Standort ein eigenes Gebäude. Die endgültige Fertigstellung der Neubauten ist für 2031 geplant. Für das Vorhaben investiert die städtische Klinikgesellschaft einen hohen dreistelligen Millionenbetrag; 250 Millionen Euro erhält sie als Förderbetrag vom Land NRW.
Von der Konzentration auf einen einzigen Krankenhausstandort verspricht sich der Klinikträger Synergien, geringere Kosten, modernere Räume, kürzere Wege, attraktive Arbeitsbedingungen und mehr Behandlungsqualität. In den vergangenen Jahren hatten die städtischen Kliniken Verluste im Bereich zwischen 80 und 100 Millionen Euro pro Jahr verzeichnet. Der Betriebskostenzuschuss aus dem städtischen Etat war über die Jahre entsprechend gestiegen und lag allein 2024 bei 73,3 Millionen Euro.
Vor Ort ist das Vorhaben jedoch nicht unumstritten, Gegner des Projekts verweisen etwa auf zukünftig längere Wege zur medizinischen Behandlung für Familien mit Kindern aus dem Linksrheinischen, einschließlich der kindermedizinischen Notfallambulanz, sowie ein Verlust der Krankenhausversorgung vor Ort. Erst im Juli 2024 hatte ein jahrelang geplanter, rund 20 Millionen Euro teurer Klinik-Anbautrakt im Kinderkrankenhaus für die Behandlung von Säuglingen, Neu- und Frühgeborenen eröffnet.