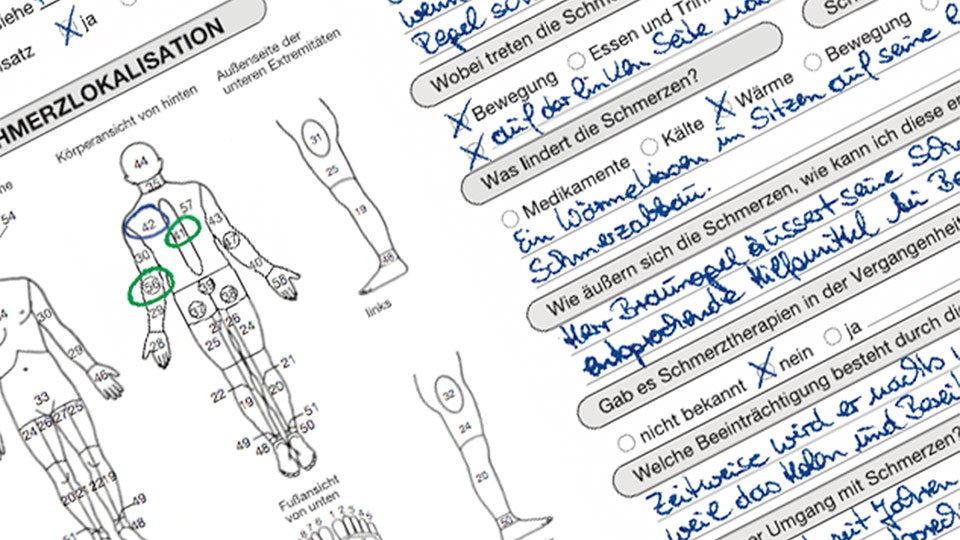
Um diese Frage zu beantworten, ist zunächst einmal voranzustellen, dass die Gewährleistung einer sachgerechten, medizinischen Behandlung und nicht die forensische Beweissicherung das vorrangige Ziel und der wesentliche Zweck der vertraglich wie deliktisch begründeten Pflicht zur Dokumentation ist. Das bedeutet zugleich, dass eine Dokumentation, die zu therapeutischen Zwecken nicht erforderlich ist, aus Rechtsgründen auch nicht geboten ist. Bloße Routinemaßnahmen sind daher ebenso wenig wie Negativbefunde zu dokumentieren, es sei denn, es besteht hierfür ein konkreter Anlass, etwa dann, wenn von vornherein ein bestimmter Verdacht auszuräumen war.
Sämtliche Beweismittel der Zivilprozessordnung stehen zur Verfügung
Abseits dieser Aspekte, die den Prinzipien der Qualitäts- und Therapiesicherung folgen, dient die Dokumentationspflicht jedoch auch zweifelsfrei der zivilprozessualen Funktion der Beweissicherung. Seit dem Inkrafttreten des Patientenrechtegesetzes im Februar 2013 gebietet § 630f Absatz 2 BGB ausdrücklich die Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht von medizinisch gebotenen Maßnahmen im vorgenannten Sinne und stellt in § 630h Absatz 3 BGB die gesetzliche Vermutung auf, dass die nicht aufgezeichneten, dokumentationspflichtigen Maßnahmen als nicht vorgenommen gelten.
Diese Fiktion ist jedoch nicht unwiderleglich. Die Vermutung des § 630h Absatz 3 BGB kann vielmehr durch den Beweis des Gegenteils entkräftet werden (§ 292 ZPO). Hierzu stehen sämtliche Beweismittel der Zivilprozessordnung zur Verfügung (§§ 371 bis 455 ZPO). Es ist obergerichtlich anerkannt,[1] dass auch das schwächste Glied in der Kette der Beweismittel, die Parteivernehmung, in die richterliche Würdigung im Hinblick auf die Vermutungswiderlegung einzubeziehen ist. Mit anderen Worten: Einer unterlassenen Dokumentation kann durch eine glaubwürdige und glaubhafte Einlassung entgegengetreten werden.
Anmerkung:
- Beispielsweise: OLG Koblenz vom 4. Juli 2016 (Az.: 5 U 565/16); OLG Dresden vom 14. September 2017 (Az.: 4 U 975/17).