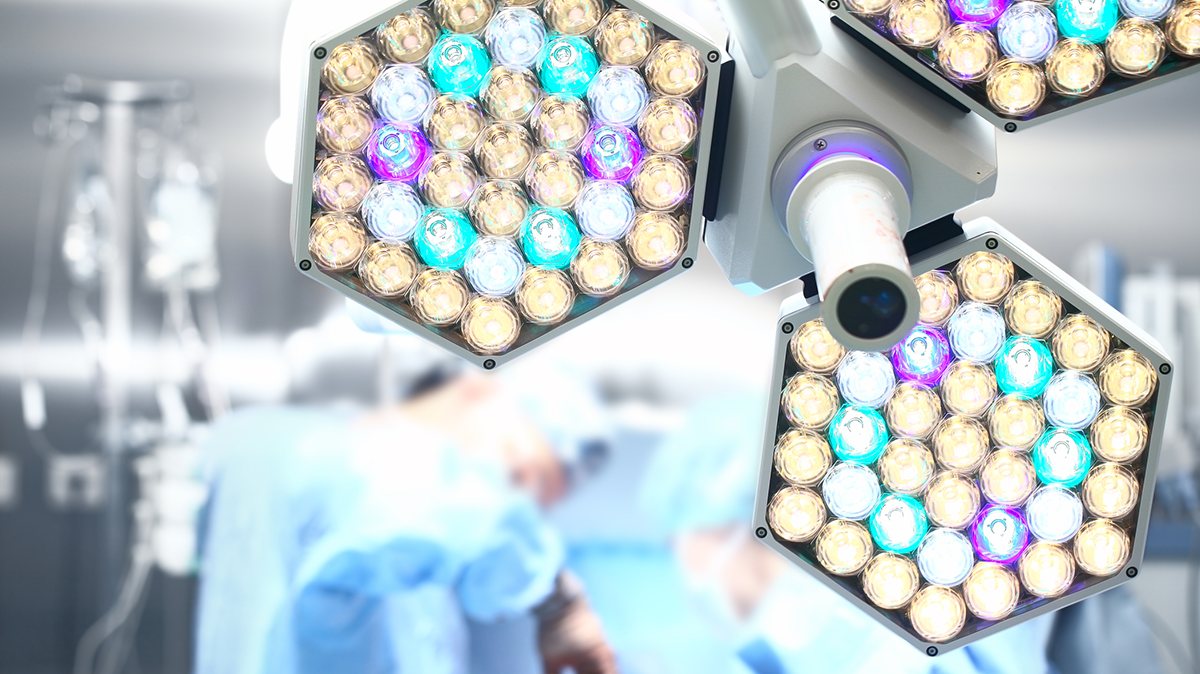
Bandscheibenvorfall führt zu Cauda-equina-Syndrom
Schon im Jahr 1998 erlitt eine Frau einen Bandscheibenvorfall und klagte seitdem über wiederkehrende Beschwerden im unteren Rückenbereich. Ab August 2015 wurden die Schmerzen immer schlimmer, was auch eine Physiotherapie nicht ändern konnte. Zusätzlich verspürte sie zunehmend eine Taubheit im rechten Bein.
Wegen der Beschwerden ging sie zunächst zu ihrem Hausarzt, der ihr eine Krankenhauseinweisung und eine Überweisung zum Radiologen gab. Der Radiologe konnte einen massiven Bandscheibenvorfall auf Höhe der Lendenwirbelsäule feststellen, bei dem die Nervenwurzel stark eingeengt wurde.
Der Radiologe ermahnte sie dazu unbedingt auf Entleerungsstörungen zu achten, da sie dann umgehend operiert werden müsste. Und tatsächlich stellte die Frau im Laufe des Tages fest, dass sie ihre Blase nicht mehr entleeren konnte und sich das Taubheitsgefühl im Unterleib ausbreitete. Sofort alarmierte sie den Rettungsdienst, von dem sie in eine Klinik gebracht wurde.
Im Rahmen der Aufnahmeuntersuchung überreichte sie den Verantwortlichen einen Datenträger mit den CT-Daten des Radiologen. In der Klinik konnte zudem eine für einen Bandscheibenvorfall typische Schmerzsymptomatik im unteren Rückenbereich und eine eingeschränkte Beweglichkeit der Lendenwirbelsäule festgestellt werden.
Die Wirbelsäule selbst stand jedoch gerade, zeigte also keine sichtbare Fehlhaltung. Ferner zeigten sich keine sensomotorischen Defizite, lediglich leichte Schwächen bei der Fußsenkungen. Fersenstand, Zehenstand und Einbeinstand konnte die Patientin sicher demonstrieren.
Notwendige Operation zu spät erkannt?
Um abzuklären, ob tatsächlich eine Operation notwendig ist und um weitere Röntgen- und MRT-Untersuchungen durchzuführen, wurde sie stationär aufgenommen. In der Nacht beklagte die Patientin erneut kein Wasser lassen zu können, woraufhin sie von einer Pflegefachkraft untersucht wurde. Diese konnte allerdings keine gefüllte Blase ertasten, weshalb sie keine weiteren Maßnahmen veranlasste.
Nach erneuten Beschwerden der Patientin und nach mehrfachem Wunsch wurde ihr schließlich ein Blasenkatheter gelegt, durch den eine große Menge Urin entleert werden konnte.
Am nächsten Tag klagte die Patientin über Taubheitsgefühle im Genitalbereich und im Unterbauch. Nach Rücksprache mit dem diensthabenden Oberarzt wurde ein Spannungstest des Schließmuskels (Prüfung des Sphinkertonus) durchgeführt. Die Prüfung ergab einen leicht verminderten Sphinkertonus, woraufhin ein beginnendes Cauda-equina-Syndrom vermutet wurde, was eine umgehende Notfall-Operation notwendig machte. Die Operation fand dann am späten Nachmittag statt.
Erklärung: Cauda-equina-Syndrom
Das Cauda-Equina-Syndrom ist eine ernsthafte neurologische Notfallsituation, die durch eine starke Kompression der Nervenfasern im unteren Rückenmark (der „Pferdeschweif“, lateinisch Cauda Equina) entsteht. Typische Symptome sind starke Schmerzen, Lähmungen in den Beinen, Taubheitsgefühl im Genital- und Analbereich („Reithosenanästhesie“) sowie Probleme mit Blasen- und Darmentleerung. Die Ursache ist oft ein massiver Bandscheibenvorfall, aber auch Tumore oder Verletzungen können dazu führen. Ohne sofortige Operation besteht das Risiko von dauerhaften Nervenschäden und Inkontinenz.
Am Folgetag der Operation wurde in der Behandlungsdokumentation vermerkt, dass das Gefühl im Genitalbereich allmählich zurückkehre. Der Katheter konnte allerdings wegen anhaltender Inkontinenz noch nicht entfernt werden.
Zwei Tage nach der OP wurde erneut ein MRT durchgeführt, was einen neuen Bandscheibenvorfall (Rezidiv-Vorfall) zeigte. Umgehend wurde eine weitere Operation durchgeführt, die schließlich Linderung verschaffen sollte.
Fünf Tage nach dieser letzten OP zeigt das MRT die vollständige Entfernung des Bandscheibenvorfalls. Dennoch blieb die Patientin vorerst weiter inkontinent, weshalb der Dauerkatheter noch nicht entfernt werden konnte. Sie wurde zur Rehabilitationsbehandlung in eine neue Klinik verlegt.
Klägerin: „Aufnahmeuntersuchung war unzureichend!“
Mit ihrer Verlegung war die Angelegenheit für die Patientin aber nicht vorbei. Sie erhob Klage vor dem LG Bielefeld gegen die Klinik, in der die Operationen durchgeführt wurden. Vor Gericht behauptete sie, dass die Aufnahmeuntersuchung in der Klinik unzureichend gewesen sein soll. Bei ihrer Einweisung teilte sie dem behandelnden Arzt mit, dass sie seit circa 10 Stunden kein Wasser mehr lassen könne und zudem Taubheitsgefühle im Schambereich sowie im rechten Bein habe. Trotzdem sei nur eine grobe Einweisungsuntersuchung durchgeführt worden – ohne neurologische Abklärung.
Wichtige Aspekte wie die Schmerzausstrahlung ins Bein und die Sensibilität im Genitalbereich seien überhaupt nicht untersucht worden. Auch sei eine Ultraschall-Untersuchung zur Bestimmung der Restharnmenge medizinisch indiziert gewesen. Allein schon aufgrund der vorliegenden CT-Daten des Radiologen hätten sofort weitere fachärztliche Befunderhebungen erfolgen müssen. Fehler sieht die Patientin auch beim Pflegepersonal. Das habe trotz mehrerer Hinweise, dass sie kein Wasser mehr lassen könne, keine weiteren fachärztlichen Untersuchungen veranlasst.
So hätte schon am Aufnahmetag der Verdacht auf ein Cauder-equina-Syndrom aufkommen können, was eine rechtzeitige Operation und die Vermeidung von irreversiblen neurologischen Folgeschäden ermöglicht hätte.
Seit der Behandlung leide sie unter dauerhaften Beeinträchtigungen wie Sensibilitätsstörungen im Genitalbereich und in den Beinen, Blasen- und Darmentleerungsstörungen, Einschränkungen der Sexualität, Kraftminderung in Beinen und Unterbauch, Beckenbodenschwäche und einer Gangstörung.
Patientin fordert Schmerzensgeld
Von der Klinik fordert sie deshalb ein Schmerzensgeld in Höhe von 75.000 Euro sowie die Zahlung von 4.757,64 Euro wegen Fahrtkosten und weiteren 5.876,51 Euro wegen Zuzahlungen zu Behandlungen, Heil- und Hilfsmitteln. Darüber hinaus seien ihr Einkommenseinbußen von 57.203,21 Euro und Haushaltsführungsschäden von 16.850,80 Euro entstanden, die ebenfalls zu begleichen wären.
Während das LG Bielefeld die Klage in erster Instanz abgewiesen hatte, zeigte die Berufung der Patientin vor dem OLG Hamm mehr Erfolg. Das Gericht kam zur Überzeugung, dass tatsächlich ein grober Behandlungsfehler (§ 630h) ursächlich für die erlittenen Beeinträchtigungen der Patientin war.
OLG Hamm – 26 U 183/23
„Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist ein Behandlungsfehler dann als grob zu bewerten, wenn der Arzt eindeutig gegen bewährte ärztliche Behandlungsregeln oder gesicherte medizinische Erkenntnisse verstoßen und einen Fehler begangen hat, der aus objektiver Sicht nicht mehr verständlich erscheint, weil er einem Arzt schlechterdings nicht unterlaufen darf.“
„Unter einem Cauda-equina-Syndrom darf die Sonne nicht untergehen“
So konnte ein Sachverständiger vortragen, dass in vorliegenden wissenschaftlichen Arbeiten Einigkeit darüber bestehe, dass bei einem vorliegenden Cauda-equina-Syndrom innerhalb von 48 Stunden nach Eintritt der Symptome eine Operation erfolgen muss, weil sonst die Behandlungsergebnisse signifikant schlechter ausfallen würden.
Der Sachverständige konnte überzeugend darlegen, dass in allen Kliniken nach dem Grundsatz gehandelt werde, dass unter einem Cauda-equina-Syndrom die Sonne nicht untergehen dürfe. In der Praxis warte man nicht ab, sondern rate sofort zur Operation – je schneller, desto besser. Nach Ansicht des Gerichts hätte eine frühere Operation eine ernsthafte Chance geboten, dass die Klägerin beschwerdefrei geblieben wäre.
Leitsatz
Bei der Annahme eines Cauda-equina-Syndroms ist der Patient umgehend zu operieren. Wird nicht umgehend operiert, kann das als grober Behandlungsfehler gewertet werden.
Der Senat hält ein Schmerzensgeld von 75.000 Euro gemäß § 253 Absatz 2 BGB für gerechtfertigt. Die Bemessung basiert auf der Schwere der Verletzungen, der Dauer des Leidens, der Beeinträchtigungen und dem Grad des Verschuldens.
Die Klägerin leidet unter Blasen- und Darmentleerungsstörungen sowie Sensibilitätsstörungen im Genitalbereich, die ihre Sexualität beeinträchtigen. Aufgrund ihres Alters von 47 Jahren erscheint die Höhe des Schmerzensgeldes angemessen.
Die Klinik muss auch für materielle und zukünftige immaterielle Schäden wegen der verzögerten Operation haften.
Gegen die Entscheidung ist eine Nichtzulassungsbeschwerden vor dem BGH eingelegt worden (Az.: VI ZR 324/24).
FAQ
Was tun, wenn ein Cauda-equina-Syndrom vermutet wird?
Ein Cauda-equina-Syndrom ist ein medizinischer Notfall und erfordert eine sofortige Abklärung durch einen Facharzt. Symptome wie Taubheitsgefühle im Genitalbereich, Lähmungen oder Probleme mit der Blasen- und Darmentleerung müssen ernst genommen und schnellstmöglich behandelt werden. Eine umgehende Operation innerhalb von 48 Stunden kann das Risiko bleibender Nervenschäden erheblich reduzieren.
Welche Symptome deuten auf ein Cauda-equina-Syndrom hin?
Typische Symptome des Cauda-equina-Syndroms sind starke Rückenschmerzen, Taubheitsgefühle in den Beinen oder im Genitalbereich sowie Lähmungserscheinungen. Besonders alarmierend sind Blasen- oder Darmentleerungsstörungen, da sie auf eine schwere Nervenkompression hindeuten. Ohne rechtzeitige Behandlung kann es zu irreversiblen neurologischen Schäden und dauerhafter Inkontinenz kommen.
Wer haftet, wenn ein Cauda-equina-Syndrom nicht rechtzeitig behandelt wird?
Wenn eine Klinik oder ein Arzt trotz eindeutiger Symptome eine notwendige Notfall-Operation verzögert, kann dies als grober Behandlungsfehler gewertet werden. In einem Urteil des OLG Hamm wurde einer Patientin Schmerzensgeld zugesprochen, weil eine zu späte Operation zu dauerhaften Beschwerden führte. Betroffene können in solchen Fällen Schadensersatz und Schmerzensgeld gemäß § 630h BGB geltend machen.
Quelle: OLG Hamm vom 13. September 2024 – 26 U 183/23